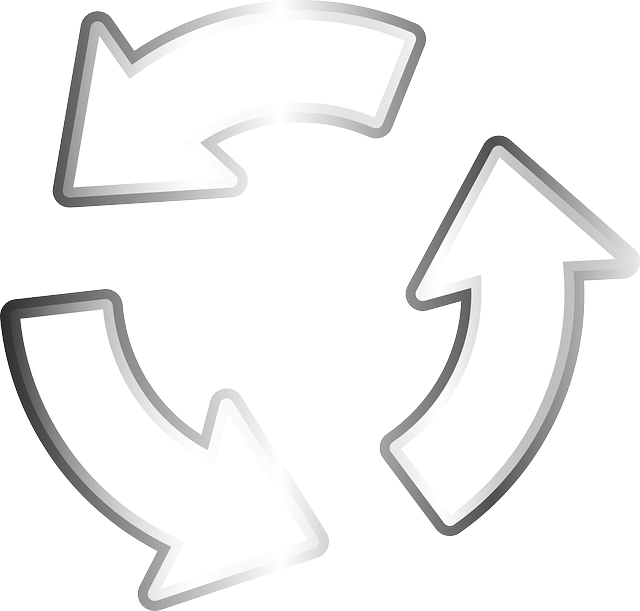Leasingmodelle bieten sowohl Selbstständigen als auch Angestellten steuerliche Vorteile. Die für diese Modelle zum Einsatz kommenden Leasingflotten werden dabei häufig auch durch professionelle Sicherheitsdienste wie unter anderem den Golden Eye Sicherheitsdienst überwacht. Bei der Wahl des Leasingmodells kann man auf Anhieb viel falsch, aber auch richtig machen. Denn sie entscheidet maßgeblich über die monatlichen Kosten und die Nutzungsflexibilität.
Die zwei Hauptmodelle: Es sind zum einen das Zeitleasing mit festen monatlichen Raten und zum anderen das Kilometerleasing. Letzteres orientiert sich an der tatsächlichen Fahrleistung. Die Unterschiede zwischen beiden Modellen könnten dabei größer nicht sein. Zu diesen gehören unter anderem ihre Kostenstruktur, Planbarkeit und die geeignete Zielgruppe. Die wichtigsten Aspekte beider Modell und für wen welches Modell am besten geeignet ist, untersuchen die nächsten Abschnitte dieses Artikels.
Grundprinzipien der Modelle
Der ausschlaggebendste Faktor bei der Leasingvertragsstruktur ist die Wahl zwischen Zeit- und Kilometermodell. So sieht auf der einen Seite das Zeitleasing eine feste monatliche Rate für eine bestimmte Vertragsdauer vor, und auf der anderen Seite orientiert sich das Kilometermodell an der tatsächlichen Fahrleistung. Das Zeitleasing basiert dabei auf einer vorab festgelegten Laufzeit, meist zwischen 24 und 48 Monaten und einer maximalen Kilometerleistung.
Im Gegensatz dazu kalkuliert das Kilometerleasing die Rate basierend auf der erwarteten Gesamtkilometerleistung. Die Besonderheit dabei? Durch die monatlichen Kosten kann die geplante Nutzung genau dargestellt werden. Ein Nachteil bei der Leasingform nach Zeit ist, dass für Mehrkilometer zusätzliche Kosten anfallen. Das kann beim Kilometerleasing zwar auch passieren, jedoch ist die Abrechnung genauer und erfolgt nach gefahrenen Kilometern. Für die monatliche Budgetplanung macht das einen großen Unterschied.
Kostenstruktur und Abrechnung
Je nach Modell folgt die Kostenberechnung beim Leasing unterschiedlichen Prinzipien. Wie bereits erwähnt, gibt es beim Zeitleasing eine feste monatliche Rate. Diese ergibt sich aus der Laufzeit und der geschätzten Fahrleistung. Und bei Mehrkilometern? In diesem Fall fallen zusätzlich Gebühren an, die typischerweise zwischen 10 und 20 Cent pro Kilometer liegen. Leider werden Minderkilometer dabei oft nur teilweise vergütet. Das dämpft die Vorfreude, wenn man es dann doch einmal geschafft hat, weniger Strecke zurückzulegen.
Beim Kilometerleasing passt sich die Rate an die tatsächlich zurückgelegten Kilometer an. Daher gibt es auch einen deutlichen Unterschied bei der Endabrechnung. So erfolgt beim Zeitleasing eine finale Kilometerabrechnung, wohingegen beim Kilometerleasing die Kosten bereits während der Laufzeit der realen Nutzung entsprechen. Die Kostenkontrolle wird dadurch beim Kilometerleasing wesentlich einfacher und vor allem transparenter.
Planbarkeit und Flexibilität
Durch die festen monatlichen Raten beim Zeitleasing entsteht eine deutlich bessere Planbarkeit. Doch das hat auch Nachteile. So schränkt dieses Modell die Flexibilität bei der Fahrleistung ein. Eine spontane Spritztour von München nach Südfrankreich endet dann gerne einmal in Mehrkosten. Denn die vereinbarte Kilometerzahl kann dadurch leicht überschritten werden.
Das kann beim Kilometerleasing eher nicht passieren. Hierbei ist eine flexible Anpassung an schwankende Fahrleistungen möglich. Die Kosten entsprechen dabei immer der tatsächlichen Nutzung. Dadurch entsteht mehr Spielraum, sollte es ab und an doch einmal zu unregelmäßigen Arbeitswegen oder wechselnden Geschäftsterminen kommen. Der Nachteil? Die monatlichen Raten können stärker schwanken. Das erschwert dann die Budgetplanung. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Kilometerleasings ist, dass durch dieses Modell hohe Nachzahlungen am Vertragsende vermieden werden können. Davor ist man beim Zeitleasing leider nicht gefeit.
Vertragsanpassung
Wenn man nun feststellt, dass das eine Modell doch nicht das Gelbe vom Ei ist, denkt der Leasingkunde eventuell über eine Vertragsanpassung nach. Doch diese unterscheidet sich deutlich zwischen den Leasingmodellen. Auch hier scheint das Kilometerleasing wieder die bessere Wahl zu sein. Denn es erlaubt meist kostengünstige Anpassungen der Laufleistung während der Vertragslaufzeit. Diese Änderungen wirken sich jedoch direkt auf die monatliche Rate aus.
Das ist beim Zeitleasing ungünstigerweise nicht so einfach. Da werden dann gerne hohe Gebühren für Vertragsänderungen verlangt. Auch ist die Anpassung der vereinbarten Kilometerzahl komplizierter und meist teurer. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei, dass beim Zeitleasing die Anpassung rechtzeitig erfolgen muss. Ansonsten kommt es zu hohen Mehrkilometerkosten.
Zielgruppen und Eignung
Für wen ist nun welches Leasingmodell am besten geeignet? Wie man eventuell bereits vermutet, eignet sich das Kilometerleasing besonders für Selbstständige und Geschäftsleute. Denn diese haben oft mit schwer planbaren Fahrleistungen zu tun. Von dieser Flexibilität können Handelsvertreter oder Berater mit wechselnden Einsatzorten profitieren.
Für Pendler hingegen eignet sich das Zeitleasing dagegen besser. Denn hier sieht der Arbeitsalltag oft gleich aus. Die Arbeitswege sind gleichmäßig und die Fahrleistung meist konstanter. Durch feste monatliche Raten wird zudem die Budgetplanung erleichtert. Der Schlüsselfaktor für die Eignung ist hier das stabile Fahrverhalten.